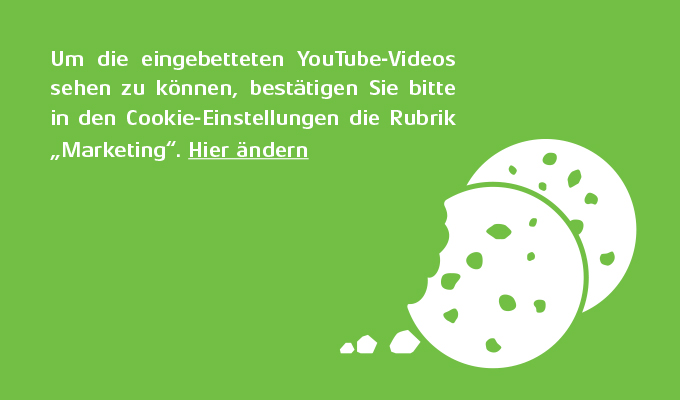Blog der IST-Hochschule
Fitness & Gesundheit

Ernährungstrends 2025 – und was sie für 2026 bedeuten
Ernährung ist heute weit mehr als reine Nahrungsaufnahme. Sie ist Ausdruck von Identität, Gesundheitsbewusstsein und gesellschaftlicher Verantwortung. Wie wir essen, was wir einkaufen und welche Werte wir mit unserer Ernährung verbinden, zeigt, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Ernährung wird persönlicher, technologischer und nachhaltiger. Doch was bleibt davon für 2026? Vieles entwickelt sich weiter. Der Blick auf die aktuellen Ernährungstrends zeigt, wie tiefgreifend sich unser Verhältnis zum Essen wandelt und welche Chancen sich daraus für Verbraucher:innen ebenso wie für Fachkräfte in der Ernährungsberatung ergeben.
WeiterlesenSport & Management

Faszientraining für Pferde: Mehr Beweglichkeit, gesunde Pferdemuskulatur und Wohlbefinden durch gezielte Übungen
Faszientraining für Pferde ist eine effektive Methode, um die Beweglichkeit zu verbessern, Verspannungen zu lösen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Faszien sind ein Netzwerk aus Bindegewebe, das Muskeln, Organe und Gelenke umhüllt. Durch gezielte Übungen und Techniken bleibt das Fasziengewebe elastisch, was die Leistungsfähigkeit deines Pferdes steigert und zur allgemeinen Pferdegesundheit beiträgt.
WeiterlesenKraft ohne Bewegung: Isometrisches Training für Pferde erklärt
Gesund durch die Boxenruhe: Fitness- und Wohlfühltipps für Dein Pferd
Spielerberater im Fußball – Die Qualität ist entscheidend
Event & Medien
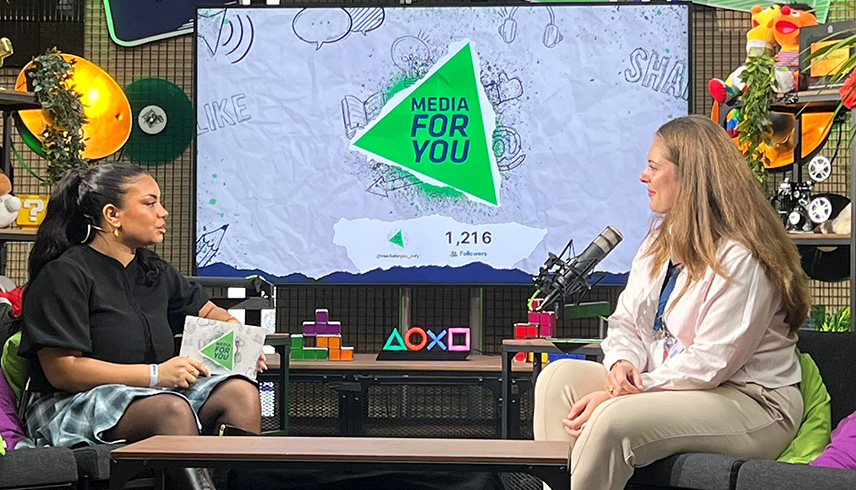
Medientage München 2025 – Medienbranche unter Druck
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Medienwelt rasanter als erwartet. Immer häufiger übernehmen Plattformen die Informationshoheit, während klassische Medienhäuser um Reichweite und Sichtbarkeit kämpfen. Auf den Medientagen München 2025 wurde deutlich: Die Branche steht unter Druck – zwischen Verantwortung, Regulierung und digitalem Wandel.
WeiterlesenDigitalisierung & Wirtschaft

Was ist Coaching? Dein Überblick über Bedeutung, Nutzen und Chancen
Du hast das Wort „Coaching“ bestimmt schon oft gehört, egal ob im Job, in Podcasts oder auf Social Media. Aber was steckt wirklich dahinter? Und vor allem: Was bringt Coaching wirklich? In diesem Beitrag schauen wir uns an, was Coaching bedeutet, wie es abläuft, was es bewirken kann und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Ganz gleich, ob Du selbst Coaching nutzen willst oder überlegst, Coach zu werden.
WeiterlesenTourismus & Hospitality

Reiseberater:in werden: Mit Fernweh zum Erfolg
Wer gerne reist, Organisationstalent besitzt und Freude daran hat, anderen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu ermöglichen, hat vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, Reiseberater:in zu werden.
WeiterlesenLernen & Studieren

Effektive Zeitmanagement-Tipps für mehr Lebensqualität
Fragst Du Dich oft, warum der Tag nicht mehr als 24 Stunden lang sein kann? Dann könntest Du alle Tätigkeiten, die Du Dir vorgenommen hattest, bestimmt besser bewältigen. Und Du hättest endlich mehr freie Zeit, Dich um Deine persönlichen Bedürfnisse, um Freunde und um Hobbies zu kümmern. Nein, die Lösung Deiner Probleme ist natürlich nicht die Verlängerung des Tages, sondern die Anwendung und Verbesserung Deines Zeitmanagements. Unsere Tipps helfen Dir, Deine Prioritäten zu erkennen, Deine Produktivität zu erhöhen und eine gute Work-Life-Balance zu erreichen– sei es im Beruf, im Studium oder in der Freizeit.
Weiterlesen
Zu den Studiengängen der
IST-Hochschule
HIER KLICKEN!
IST-Hochschule
Zu den Weiterbildungen des
IST-Studieninstituts
HIER KLICKEN!
IST-Studieninstitut