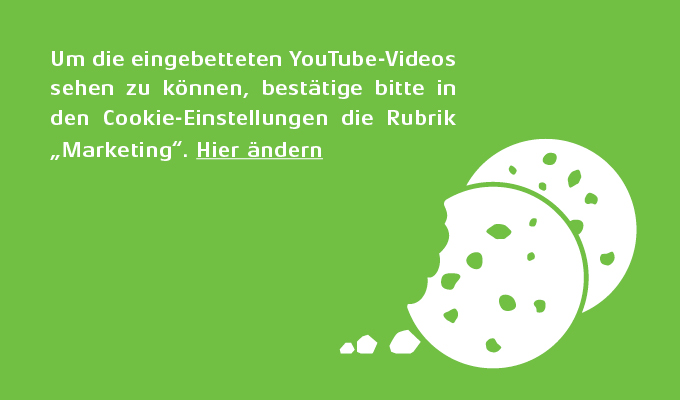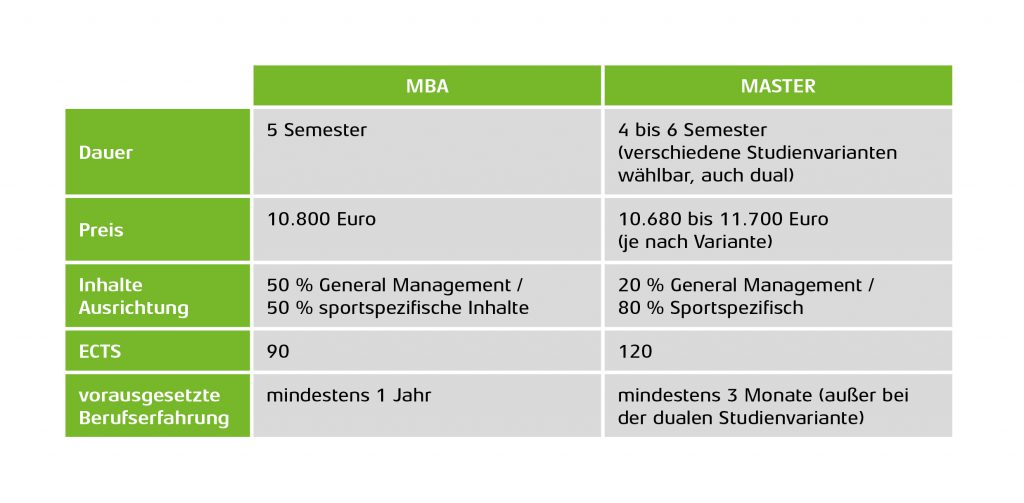In der heutigen Gesellschaft wird der Mensch mit unzähligen industriell gefertigten Lebensmitteln konfrontiert. Übergewicht, Krankheiten und der Wunsch nach einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sind häufiger Anlass, den eigenen Ernährungsstil zu hinterfragen: Welche Nahrungsmittel sind verträglich? Wie erkenne ich Fett- und Zuckerfallen?
Der Trend geht hin zur gesunden Ernährung
Clean Eating ist in Mode, Paleo besinnt sich auf vergangene (Stein)Zeiten und vegane Ernährung ist wieder sexy. Nicht nur die Entwicklung zahlreicher Ernährungstrends, sondern auch das Wissen um die Bedeutung von Nährstoffen und das Zusammenspiel zwischen Essen und Psyche rufen den Ernährungsberater auf den Plan. Die Leidenschaft zum Beruf machen und Ernährungsberater werden! Davon träumen viele – Du auch? Aber was genau macht ein Ernährungsberater und welche Ausbildungsformen gibt es?


Was macht eigentlich ein Ernährungsberater?
Von der Analyse bis hin zum Ernährungsplan muss der Ernährungsberater seine Kunden individuell beraten können. Ernährungsberater werden nicht nur mit dem klassischen Wunsch des Abnehmens konfrontiert, sondern auch mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder psychischen Erkrankungen, die mitberücksichtigt werden müssen.
In der Regel dient das erste Gespräch mit dem Kunden dazu, Ess- und Lebensgewohnheiten in Erfahrung zu bringen. Gesundheitliche und körperliche Voraussetzungen werden geprüft, das Gewicht bestimmt und eine Messung des Körperfettanteils durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wird schließlich ein individueller Ernährungsplan erstellt.
Der Ernährungsberater schult den Kunden, achtsam mit dem eigenen Ernährungsverhalten umzugehen. Ein Ernährungstagebuch hilft dabei, neu gesteckte Ziele im Blick zu behalten und das eigene Essverhalten zu überwachen. Regelmäßige Check-ups dokumentieren den Erfolg der Ernährungsumstellung. Denn das Ziel ist eine langfristige Anpassung der Ernährung – getreu dem Motto „Iss Dich glücklich und gesund.“
Ernährungsberater werden – so geht`s
Wenn Du Ernährungsberater werden möchtest hast Du viele Möglichkeiten, denn eine einheitliche Ausbildung zum Ernährungsberater gibt es nicht. Ob ein Studium im Bereich Ökotrophologie und Ernährungswissenschaften, eine Ausbildung als Diätassistent oder eine Weiterbildung im Bereich der Ernährungsberatung: die Ausbildungswege sind vielfältig und abhängig von Deiner Schwerpunktsetzung und dem gewünschten Ziel.
Wenn Du Dir kompaktes Wissen aneignen möchtest, ist die 3-monatige Weiterbildung zum Ernährungsberater genau das richtige für Dich. Diese kurze Ausbildung eignet sich besonders für Fitness- oder Personaltrainer und Mitarbeiter aus der Wellness- oder Gesundheitsbranche, die ihr Profil um das Wissen gesunder Ernährung erweitern möchten. Aber auch Quereinsteiger erhalten durch die Weiterbildung viele Tipps rund um die Themen: gesunde Ernährung, Nährstoffe und ihre Aufgaben, Verdauung und Stoffwechsel sowie Essen und Psyche.
Alternativ kannst Du über einen längeren Zeitraum von 14 Monaten die Weiterbildung zum Ernährungscoach absolvieren. Die umfangreiche Ausbildung eignet sich insbesondere für diejenigen, die eine Selbständigkeit anstreben. Das Zertifikat zum „Ernährungsberater“ ist hierbei schon inklusive. Neben den wichtigen Themen rund um die Ernährungsberatung werden auch Essverhalten, Ernährungstrends, Bewegungsformen und Gewichtscoaching thematisiert.
Inhalte der Ausbildungen zum Ernährungsberater und Ernährungscoach
Folgende Inhalte der Ausbildung zum Ernährungsberater werden Dir in einem Zeitraum von 3 Monaten vermittelt:
- Grundlagen der Ernährung
- Professionelles Ernährungscoaching
- Ernährungsberatung
- Ernährungscoaching in der Praxis
Ausführliche Informationen zu den Inhalten kannst Du dem Lehrplan zum Ernährungsberater entnehmen.
Die Ausbildung zum Ernährungscoach dauert 14 Monate. Die Inhalte setzen sich aus verschiedenen Schwerpunkten zusammen. Neben den Grundlagen der Ernährung und der Ernährungsberatung werden auch Themen wie Lebensmittellehre, Gewichtscoaching und die Selbständigkeit als Ernährungscoach behandelt:
- Grundlagen der Ernährung
- Professionelles Ernährungscoaching
- Ernährungsberatung
- Ernährungscoaching in der Praxis
- Lebensmittellehre
- Ernährungstrends
- Fit und gesund durch kreatives Kochen
- Grundlagen und Trends des Gewichtcoachings
- Professionelles Gewichtscoaching
- Sport- und Gewichtscoaching in der Praxis
- Essverhalten und-störungen
- Ernährungsformen verschiedener Länder, Kulturen und Religionen
- Ernährungscoaching für spezielle Zielgruppen
- Business und Selbständigkeit im Ernährungscoaching
Ausführliche Informationen zu den Inhalten kannst Du dem Lehrplan zum Ernährungscoach entnehmen.
Ernährungsberater werden im Fernstudium


Beide Ausbildungen zum Ernährungscoach und Ernährungsberater werden im Fernstudium angeboten. Durch die Form des berufsbegleitenden Fernunterrichts genießt Du größtmögliche Flexibilität. Die Studienhefte gibt es sowohl in gedruckter Form als auch digital in Deinem
Online-Campus. Online-Vorlesungen können von überall aus abgerufen werden und ermöglichen Dir so ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Aber auch die Praxis kommt nicht zu kurz. In ein bis maximal vier Seminaren an den Wochenenden wird Dir nachhaltiges Wissen vermittelt, um eine kompetente Ernährungsberatung durchführen zu können. Beratungstechniken, Ernährungsstrategien und das Erstellen von Ernährungsprotokollen werden so an praktischen Fallbeispielen geübt. Natürlich lernst Du vor Ort auch Deine Dozenten kennen, kannst Dich mit Deinen Kommilitonen vernetzen und wirst auf die Abschlussprüfung vorbereitet.
Ausbildung beendet und dann?
Nach der Ausbildung zum Ernährungsberater streben viele den Weg der Selbständigkeit an und gründen ihre eigene Praxis. Wer sich in einem Angestelltenverhältnis wohler fühlt hat die Möglichkeit in folgenden Einrichtungen als Ernährungsberater zu arbeiten:
- Fitnessclubs
- Sportverbände
- Wellnesseinrichtungen
- Gastronomie- und Hotellerie
- Bildungs- und Sozialeinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
Egal ob selbstständig oder angestellt: Mit Deinem Fachwissen wirst Du anderen zu einem besseren Lebensgefühl verhelfen, denn das richtige Essen beeinflusst die Laune und natürlich auch die Gesundheit des Menschen. Mache jetzt den ersten Schritt und Informiere Dich über unsere Weiterbildungen zum Ernährungsberater und Ernährungscoach.