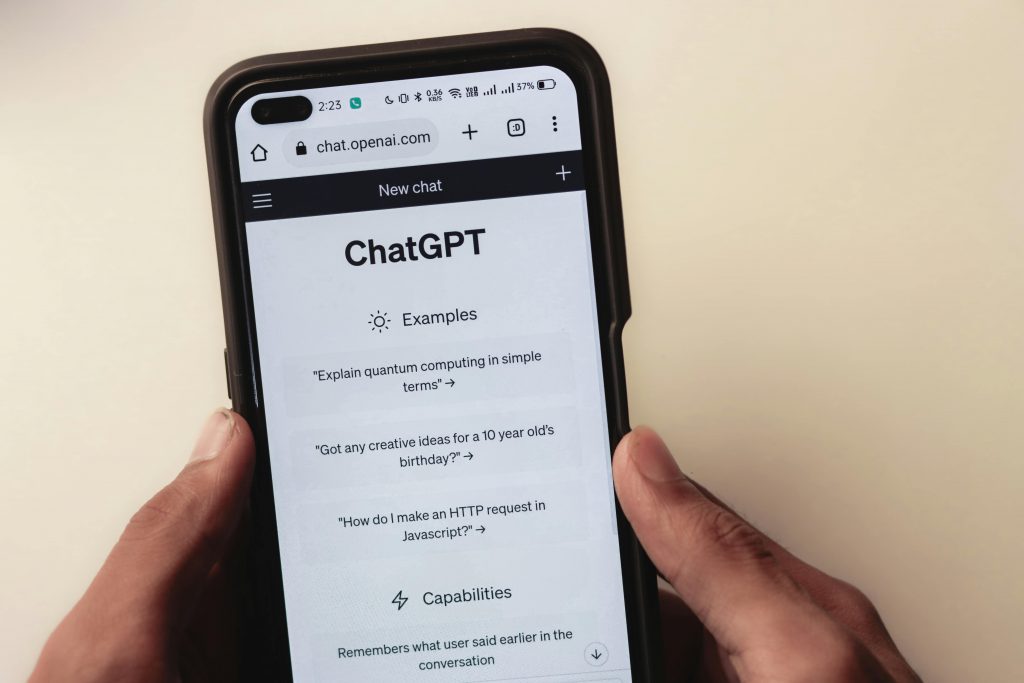Die Welt des professionellen Fußballs hat sich seit Beginn der 1990er-Jahre stark verändert. Sie ist nicht nur schneller, internationaler und medialer geworden – sie ist heute vor allem ein globales Milliardengeschäft. Durch TV-Vermarktung, Sponsoring, Merchandising und Ticketverkäufe erzielen Spitzenklubs jährlich Umsätze in Milliardenhöhe. Wie in kaum einem anderen Geschäftsfeld sind sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg dabei unmittelbar miteinander verknüpft. Der sportliche Erfolg wiederum hängt maßgeblich von der Qualität der Spieler ab – und genau hier beginnt die Arbeit der Spielerberater.
Eine Branche im Aufschwung – und im Umbruch
Was ursprünglich als nordamerikanisches Phänomen begann, hat sich auch in Europa fest etabliert. Spielerberater agieren als Bindeglied zwischen Spieler, Verein und Markt. Die Entwicklung in Deutschland spricht für sich: Waren es 1993 nur einige wenige offiziell lizensierte Spielervermittler, lassen sich Anfang 2025 über 1.660 Spielerberater zählen. Diese Zahl wird sich durch neue Lizenzstandards vermutlich bald weiter differenzieren.
Ein Meilenstein war die 2015 von der FIFA beschlossene Abschaffung der Lizenzpflicht für Vermittler. In der Praxis führte dies jedoch zu erheblichen Problemen. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: 2024 trat das neue Regelwerk der FIFA Football Agent Regulations (FIFA, 2024) in Kraft, das unter anderem wieder eine verbindliche Lizenzierung vorschreibt. Ein zentrales Element ist dabei eine Online-Lizenzprüfung (FIFA, 2025). Wer als Berater tätig sein will, muss diese Prüfung erfolgreich ablegen – ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung.
Beraten statt beeinflussen – Qualität als zentraler Baustein
Spielerberater übernehmen eine zentrale Rolle im Karrieremanagement junger und erfahrener Fußballprofis. Sie vermitteln nicht nur Verträge, sondern übernehmen auch Aufgaben im Bereich Vermarktung, PR, Rechtsberatung, Karriereplanung oder persönliche Betreuung. Der Anspruch ist hoch – doch der öffentliche Ruf ist schlecht. Die Enthüllungen rund um Football Leaks haben 2018 verdeutlicht, wie intransparent und teilweise eigennützig in diesem Markt agiert wurde. Die Recherchen von Buschmann et al. (2018) zeigten, dass in vielen Fällen persönliche Profite wichtiger waren als das Wohl der betreuten Spieler.
Dass dieser schlechte Ruf nicht unbegründet ist, zeigen auch empirische Daten (Kelly & Chatziefstathiou 2018): die Studie von Gohritz et al. (2022a) belegt, dass 50–60 % der Spieler die Arbeit ihrer Berater aktiv kontrollieren – oder durch Dritte überprüfen lassen. Das Vertrauen ist also oft begrenzt. Die Realität ist sogar noch ernüchternder: Viele Spieler berichten von Beratern, die nicht in ihrem Interesse handeln, sondern ihre eigenen Agenden verfolgen (Gohritz, 2022a).
Ein prominentes Beispiel ist Jonathan Tah, Nationalspieler und Bundesliga-Profi, der 2021 gegen seinen ehemaligen Berater Claudio Bega Strafanzeige wegen Erpressung stellte. Der Berater hatte ihn einst beim Hamburger SV betreut – der Vertrauensbruch zeigte sich jedoch erst Jahre später (Sport1, 2022).
Zwischen Zufriedenheit und Bruch – Eine ambivalente Beziehung
Die Beziehung zwischen Spielern und ihren Beratern ist häufig ambivalent. In der Studie von Gohritz et al. (2022b) zeigt sich, dass Fußballprofis mit aktuellen Beratern oft zufrieden sind, gleichzeitig jedoch mit früheren Agenten sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Diese Unzufriedenheit führt in vielen Fällen zur Beendigung der Zusammenarbeit (Gohritz et al., 2025). Solche Brüche haben langfristige Auswirkungen auf die Karriere der Spieler – sie verlieren nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit und Chancen.
Auch der ehemalige Superstar Zlatan Ibrahimovic hat in seiner Autobiografie („Ich bin Zlatan Ibrahimovic“, 2013) von einem drastischen Vertrauensbruch berichtet: Sein damaliger Berater, der den Wechsel von Malmö FF zu Ajax Amsterdam abwickelte, soll erhebliche qualitative Mängel bei der Ausübung seiner Tätigkeit gezeigt haben. Ibrahimovic distanzierte sich später vollständig von ihm.
Professionalisierung durch Weiterbildung – Ein Muss für die Zukunft
Die strukturellen Probleme im Markt der Spielerberater machen deutlich: Qualität entscheidet. Ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, ethischem Bewusstsein und Kommunikationsfähigkeit ist heute keine Option mehr – sondern eine Notwendigkeit.
Wie Gohritz (2024) betont, ist die Sicherstellung von Qualität ein wirksamer Hebel, um den Markt zu verbessern und sich als Berater langfristig zu etablieren. Eine fundierte Aus- und Weiterbildung ist daher ein zentraler Schlüssel für (angehende) Spielerberater. Insbesondere in Anbetracht der neuen FIFA-Lizenzbedingungen ist es entscheidend, nicht nur formal, sondern auch inhaltlich vorbereitet zu sein.
Weiterbildung zum/zur zertifizierten Spielerberater:in – Ihre Chance, Teil der Lösung zu sein
Wer selbst den Unterschied machen und als Spielerberater:in agieren möchte, kann jetzt mit der Weiterbildung zum:zur Spielerberater:in Fußball auf echtes Know-how setzen.
Quellen
Buschmann, R. & Wulzinger M. (2018). Football-Leaks. Penguin Verlag, München.
FIFA (2024). FIFA-Football-Agent-Regulations. Zürich https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf
FIFA (2025). Circular no. 1919. Zürich. https://digitalhub.fifa.com/m/add25cfead438b/original/Circular-1919_Amendments-to-the-Football-Agent-Regulations-and-implementation-of-an-online-exam-as-of-2025.pdf
Gohritz, A., Hovemann, G. & Ehnold, P. (2022a). Opportunistic behaviour of players’ agents in football and its monitoring by the players – an empirical analysis from the perspective of the players. German Journal of Exercise and Sport Research. 53 (3), 275–287.
Gohritz, A., Hovemann, G. & Ehnold, P. (2022b) ‘Football agents from the perspective of their clients: services, service evaluation, and factors that create satisfaction’, Int. J. Sport Management and Marketing, 22 (5-6), 361–384.
Gohritz, A. (2024). Spielerberater:innen im deutschen Fußball: Eine empirische Untersuchung zur Berufsausübung und möglichen Konfliktpotenzialen aus Sicht der Spieler. Leipzig.
Gohritz, A., Handle, S., & Ehnold, P. (2025). ‘Is that Allowed?’—A Qualitative Study on Perceptions of and Dealing with Opportunistic Behaviour Among Football Agents. Journal of Global Sport Management, 1–22. https://doi.org/10.1080/24704067.2025.2502912
Ibrahimovic, Z. (2016), Ich bin Zlatan: Meine Geschichte. [I am Zlatan: My story] (6th ed.). Piper, Munich.
Kelly, S., & Chatziefstathiou, D. (2018). ‘Trust me I am a Football Agent’. The discursive practices of the players’ agents in (un)professional football. Sport in Society, 21 (5), 800–814.
Sport1 (2022). Tah bedroht? Anwalt bestätigt Anzeige https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/04/jonathan-tah-stellt-strafanzeige-gegen-vermeintlichen-spielerberater