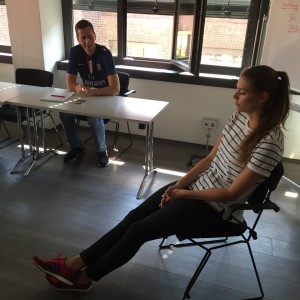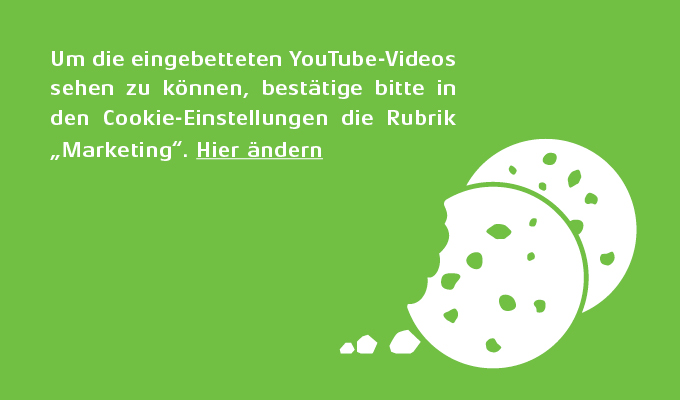Kreatin gehört zu den am meisten konsumierten Nahrungsergänzungsmitteln und steht immer mal wieder im Fokus der Berichterstattung, wenn es um die Themen „schneller Muskelaufbau“ und „unerlaubte Hilfsmittel“ im Fitnessbereich geht. Zuletzt forderte der Personal Trainer Jörn Giersberg bei SternTV, dass es auf die Dopingliste gehöre, weil es Trainierenden einen deutlichen Leistungsschub im Hinblick auf Kraft und Muskelmasse bringen würde. Ist es also ein legales Wundermittel oder wird seine Wirkung nur überhöht?
Eins vorneweg: Kreatin ist kein Steroid und hat auch keine steroidähnliche Wirkung. Es kann ganz legal erworben werden, und auch wenn es einige kleine Nebenwirkungen hat, sind diese nichts im Vergleich zu dem, was „echte“ Steroide im Körper anrichten können. Was aber ist Kreatin überhaupt?


Kreatin und die Muskeln
Kreatin(-monohydrat) ist ein Energieträger, der im Körper natürlich vorkommt und zu 95 Prozent in der Muskulatur gespeichert wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Muskelkontraktion. Vor allem beim Beginn einer hohen Belastung mit einer hohen Intensität wird es aktiv, da die Energiegewinnung im Muskel durch Kreatin ohne Sauerstoff und ohne Laktatbildung abläuft. Es kann sowohl vom Körper aus den Aminosäuren L-Arginin, L-Glycin und L-Methionin in Leber und Niere hergestellt, aber auch durch die Nahrung zugeführt werden. Vor allem rotes Fleisch und Fisch enthalten einen hohen Anteil.
Was bringt es beim Training? Es wirkt sowohl auf die schnell kontrahierenden wie auch auf die langsam kontrahierenden Muskelfasern. Es sorgt dafür, dass man länger und vor allem härter trainieren kann, da es die Ermüdung der Muskulatur hinauszögert. Es können also pro Satz mehr Wiederholungen durchgeführt oder beispielsweise Sprintbewegungen explosiver ausgeführt werden. Gleichzeitig verkürzt es die Regenerationszeiten. Voraussetzung dafür ist, dass der Speicher im Körper gut gefüllt ist. Letztgenanntes ist nicht nur für Kraftsportler, sondern auch für Ausdauersportler interessant. Insbesondere Radfahrer und Langstreckenläufer profitieren von Kreatin.
Jetzt wird es aber von vielen Trainierenden vor allem für den Muskelaufbau genutzt und nicht zwangsläufig, um beim Gewichtanheben explosiver zu sein. Hier werden immer wieder mal 5 Kilogramm Muskelmasse in 3 Wochen durch die Einnahme von Kreatin versprochen. Das aber kann Kreatin tatsächlich nicht leisten. Es ist ein legales Mittel und kann damit keine Wunder bewirken. Der Massezuwachs findet vor allem in Form von Wasser statt, das in den Muskeln eingelagert wird. Denn Kreatin fördert eine Einlagerung von Wasser in der Muskulatur, was diese praller wirken lässt. Lässt man das Kreatin dann aber wieder weg, verschwinden auch die Wassereinlagerungen und damit die größeren Muskeln. Trotzdem kann Kreatin beim Muskelaufbau unterstützen. Aber eben nur indem es die Ermüdung verzögert und die Regeneration beschleunigt, was härteres und häufigeres Training erlaubt.
Finger weg von Kuren!
Apropos weglassen: Ganz oft werden sogenannte Kreatin-Kuren durchgeführt, bei denen man 20 Gramm aufwärts täglich konsumiert. Das sorgt nicht nur für übermäßige Wassereinlagerungen und ein „schwammiges“ Aussehen, sondern führt auch zu gewissen „Nebenwirkungen“. Das liegt daran, dass der Körper nur eine bestimmte Menge des Supplementes aufnehmen kann. Der Rest sucht sich schnellstmöglich einen Weg nach draußen und das in Form von Durchfall und Erbrechen. Viel sinnvoller als eine kurzzeitig erhöhte Aufnahme ist eine regelmäßige Supplementierung. Hier kommt es zu keinen Nebenwirkungen, keiner Nierenüberbelastung, sondern vor allem zu den positiven Wirkungen des Kreatins. Eine Aufnahme von 5 Gramm pro Tag ist ungefährlich und absolut ausreichend, um die Speicher gefüllt zu halten. Neben den Wirkungen im Training wirkt es sich zusätzlich positiv auf Herz, Hirn, Augen und Haut aus.
Trainierende, die viel Fleisch essen, brauchen sogar weniger, da sie bereits viel Kreatin mit der Nahrung aufnehmen. Das zusätzlich zugeführte kann dann gar nicht mehr wirken. Aber gerade Vegetarier und Veganer können stark von einer Supplementierung profitieren. Sogar in der Medizin wird Kreatin manchmal verschrieben. Menschen, die unter starkem Stress oder Parkinson leiden, bekommen oftmals vom Arzt Kreatin.
Fazit
Niemand muss Kreatin nehmen, das trifft genauso wie bei jedem anderen Supplement zu. Wer es aber zu sich nimmt und täglich mit maximal 5 Gramm supplementiert, wird über einen langen Zeitraum profitieren. Die Wirkung ist aber nicht so stark, dass man unglaublich schnelle Zuwächse in sehr kurzer Zeit haben wird. Wer im Training länger durchhalten und seine Regenerationszeiten verkürzen möchte, der kann sich eine Aufnahme in seinen Supplement-Plan durchaus überlegen. Dann reicht aber auch normales Monohydrat. Niemand muss zu teuren Kre-Alkaly-Pulvern oder ähnlichem greifen.
Alles Wissenswerte zur Sporternährung gibt es unter anderem im Rahmen des Spezialisierungsfachs beim Bachelor Fitness and Health Management oder in der Weiterbildung Sporternährung.