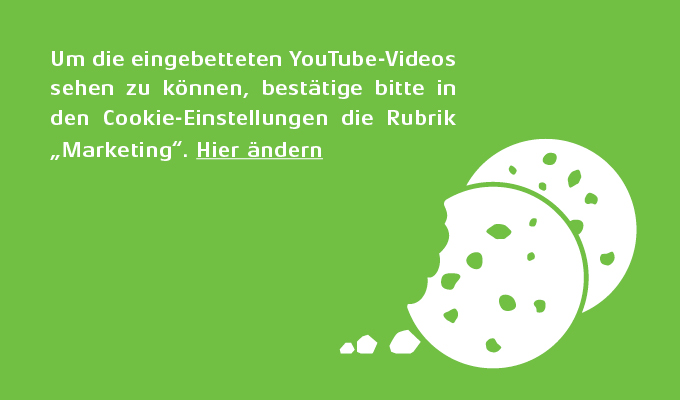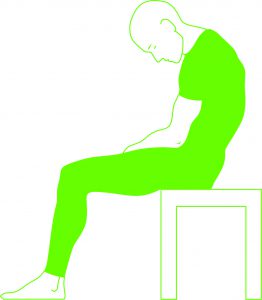Körper, Geist und Seele – Yoga verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der alle drei Komponenten in Einklang bringt. Richtig ausgeführt befreit Yoga von zahllosen körperlichen Beschwerden, fördert die Konzentration und wirkt beruhigend.
Eine besonders dynamische Form des Yoga ist Vinyasa Yoga. Das bewusstseinserweiternde Training synchronisiert Atmung und Bewegung in fließenden Bewegungsabläufen. Vinyasa Yoga (auch Flow genannt) ist ein körperbetonter Yoga-Stil, der für Kraft und Ausgeglichenheit sorgt. Aber was genau ist Vinyasa Yoga?
Vinyasa Yoga Herkunft und Definition
Vinyasa Yoga hat sich aus dem Hatha Yoga, der ursprünglichen Yoga-Form entwickelt und ist eng verwandt mit Ashtanga Yoga. Die Begrifflichkeiten werden zum Teil auch synonym verwendet. Vinyasa ist dem Sanskrit entnommen und setzt sich aus der Silbe vi (auf eine bestimmte Weise) und nyasa (setzen, stellen, legen, anordnen) zusammen. Diese spezielle Yoga-Technik konzentriert sich auf das Zusammenspiel von Asanas (Bewegung) und Pranayama (Atmung), die auf eine bestimmte Weise ausgeführt werden. In einem seriellen Fluss reihen sich die Bewegungen aneinander, ohne den Atem außer Acht zu lassen. Der „siegreiche Atem“, auch Ujjayi-Pranayama genannt, ist dabei eine spezielle Atemübung, die beim Entspannen hilft und das Denken verflüchtigt. Sie wird auch als „Sieg über das Denken“ bezeichnet.
Eine der bekanntesten Vinyasa-Serien ist der Sonnengruß. Er stärkt den Körper, kräftigt die Muskulatur, löst Verspannungen und weckt den Geist.
Ist Vinyasa Yoga für mich geeignet?
Vinyasa Yoga ist ein sportlicher Yoga-Stil, der den eigenen Geist stärkt und die Wahrnehmung im Hier und Jetzt intensiviert. Viele Menschen praktizieren Vinyasa Yoga, um Verspannungen und Stress zu lösen, den Alltag hinter sich zu lassen und mit sich selbst im Einklang zu sein.
Um die eigene Erfahrung mit Vinyasa Yoga zu intensivieren oder gar selbst Yoga-Kurse zu unterrichten, gibt es die Möglichkeit, sich zum Vinyasa Yoga-Instructor weiterzubilden. Im Interview hat IST-Gesundheitsexperte Simon Kellerhoff Annette Bach, Yoga-Lehrerin und Dozentin des IST-Studieninstituts für die Weiterbildungen „Yoga-Lehrer“ und „Vinyasa-Yoga-Instructor“, gefragt, was den dynamischen Stil „Vinyasa Yoga“ ausmacht, für wen er geeignet ist und was man in der Weiterbildung zum „Vinyasa Yoga-Instructor“ lernt.
Simon Kellerhoff: Annette, für wen ist Vinyasa Yoga geeignet?
Annette Bach: Vinyasa Yoga eignet sich für alle. Vinyasa Yoga besagt nur, dass die Übungen Atmungs- und Bewegungssynchron sein sollen. Man muss nicht direkt in den Handstand oder in die Brücke gehen. Jemand der älter und vielleicht nicht so routiniert ist verbindet Atmung und Bewegung einfach auf seine Weise. Genauso wie jemand, der es schon x-fach geübt hat und unglaublich sportlich ist.
Yoga wird gerne empfohlen, um die innere Balance zu finden. Siehst Du Vinyasa Yoga auch als geeignete Yoga-Art, um dieses Ziel zu erreichen?
Bach: Auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wo das Herz hinmöchte. Der eine möchte vielleicht eine Yoga-Form finden, die statischer oder gehaltener ist und bei der man mehr Zeit hat. Dann gibt es eine andere Version, die energetischer oder esoterischer ausgeprägt, ist und eine weitere, die dynamischer und fließender ist. Alle Versionen beherbergen den Anspruch von innerer Balance. Das ist gleichzusetzen mit dem allgemeinen Anspruch des Yoga, zu einer Freiheit zu kommen. Denn in der Freiheit stecken Entspannung und Gelassenheit. Insofern ist nur der Zugangsweg verschieden, denn letztendlich ist die Balance mit dir selbst bedeutsam, die Ausgeglichenheit.
Ausgeglichenheit und Konzentration hört sich erstmal gegensätzlich an.
Bach: Es geht immer darum, den Geist in eine innere Ruhe zu bringen. Wenn jemand Konzentrationsfähigkeit mitbringt ist das natürlich förderlich und er gelangt schneller in diesen Zustand. Derjenige der sich nicht konzentrieren kann, für den ist es läuternd, denn er lernt Konzentrationsfähigkeit durch Yoga. Wenn du atmest und dich bewegst, lernst du den Zustand von Konzentration. Atmung und Bewegung sind wie ein Türöffner nach innen. Und wenn du zusätzlich lernst den Blick oder die Sinne nach innen zu richten, entsteht daraus Konzentration.
Zum Thema Meditation – Asanas, Achtsamkeit. In wie weit spielt dies im Vinyasa Yoga eine Rolle oder wie bringt man das zusammen?
Bach: Man kann sich das so vorstellen: Wasser fließt und findet seinen Weg. Und wenn du im Fluss bist, beherbergt das schon eine Ruhe. Meditation ist wortwörtlich das Medi zur Mitte, der Dreh- und Angelpunkt, der in irgendeiner Weise zu dir führt. Wenn du innerhalb der Bewegung oder des Vinyasa Yogas zur Ruhe kommst und abschaltest, nichts mehr mitbekommst und nur noch mit dir und der Bewegung bist, dann ist das Meditation in Bewegung. Das ist das, was Ashtanga Yoga in seiner traditionellen Übersetzung auch sagt. Vinyasa Yoga ist nur eine etwas modernere Form. Es wird die Körperübung oder die Körperhaltung genutzt, um zu meditieren. Andere würden sich vielleicht in den Lotus-Sitz setzten und zur Meditation kommen. Wiederum andere bewegen sich. Der Übernächste spült ab und kommt zur Meditation. Also was ist Meditation? Ich glaube Meditation heißt „bei sich ankommen“, „zur Mitte kommen“. Und Achtsamkeit ist eine Haltung. Übungen sind nichts anderes als eine Haltung, du hältst etwas. Aber in einer Haltung durchlässig zu werden, das ist ein Stück Achtsamkeit. Du erfährst eine andere Bewusstseinsebene und das ist das, was entspannt. Das lernst du.
Apropos lernen. Was lernen die Teilnehmer in der Weiterbildung zum Vinyasa Yoga-Instructor?
Bach: Die Teilnehmer lernen von Anfang an die Grundzüge: fließendes Bewegen in Verbindung mit der typischen Atmung Ujjayi. Das ist die Basis.
Wie wichtig ist es vor der Ausbildung zum Vinyasa-Yoga-Instructor bereits praktische Erfahrungen gemacht zu haben?
Bach: Ich persönlich finde es schön, wenn ich Neulinge habe. Gut ist es aber, wenn ein Know-how und eigene Yogaerfahrung vorhanden sind. Jeder Sport bildet eine gute Grundlage und Symbiose mit Yoga.
Was ist die größte Herausforderung für die Teilnehmer?
Bach: Den großen Hintergrund zu verstehen. Vordergründig sieht es so einfach aus und erscheint so banal wie eine moderne, galante Gymnastik. Aber ohne den Hintergrund der Philosophie ist es nicht wirklich Yoga. Wenn du merkst, dass Atmen und Bewegen eine Einheit ist, nicht nur für dich selbst, sondern auch in der Gruppe, dann ist das schon Heilsam, dann lebst du schon Yoga. Yoga hält sich seit 2,5 Tsd. Jahren und wird es auch in der Zukunft noch geben. Die Frage ist: Wie bekommt man den Zauber weitergegeben? Wie springt der Funke über. Und das kann eigentlich nur ein Lehrer, der es lebt.
Wie würdest du die Belastung als Yoga Lehrer sehen? Man gibt ja auch ziemlich viel von sich preis und Energie ab. Ist es überhaupt auf Dauer haltbar mehrere Stunden am Tag Yoga zu unterrichten?
Bach: Das ist eine gute Frage. Ich mache das jetzt seit über 10 Jahren hauptberuflich und meine Lehrtätigkeit beim IST kommt noch hinzu. Es ist viel, aber ich sitze noch hier und bin immer noch ganz vital und fit und ich weiß, ich kann das bis an mein Lebensende machen. Ja ich gebe viel Energie raus, aber ich lerne als Yoga-Lehrer auch bei mir zu sein. Und es geht nicht darum, die Energie nach außen zu verschleudern. Ganz im Gegenteil, du sollst ja an der Stelle Vorbild sein und in dem Maße Energie abgeben, dass du mit dir noch im Reinen bist. Das lernst du. Du lernst bei dir zu bleiben und wenn du das kannst, machen die anderen es automatisch mit. Das ist ein Phänomen. Das ist Bindung.
Wer mehr zum Kurs wissen oder Annette Bach im Kurs erleben möchte, ist eingeladen, am Vinyasa-Yoga-Instructor oder am Yoga Lehrer teilzunehmen. Die Infos finden Sie wie immer auf www.ist.de.