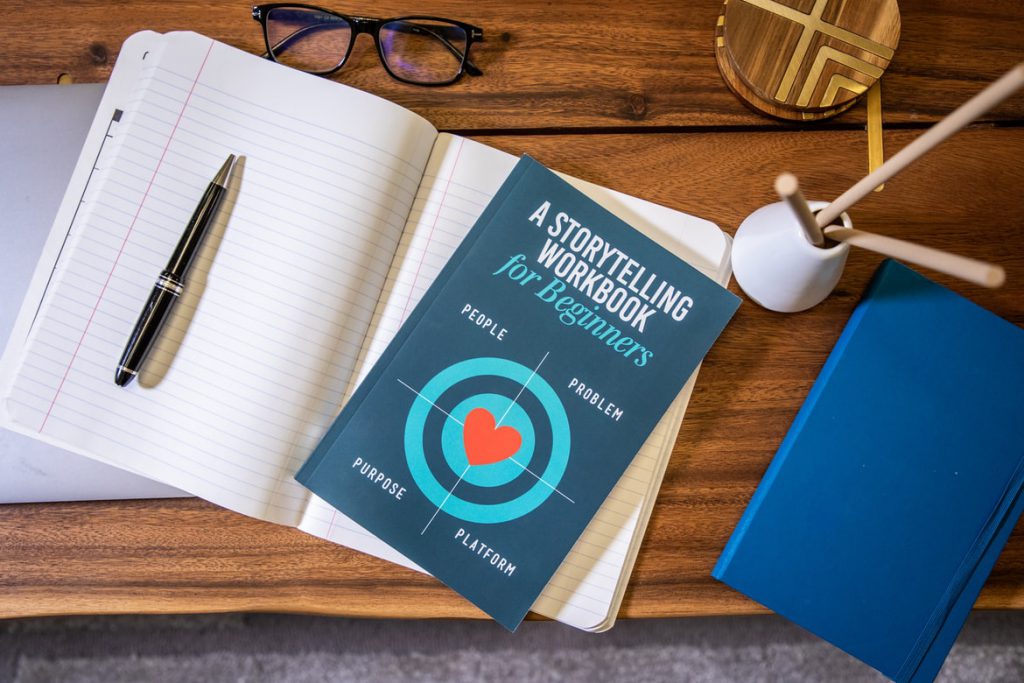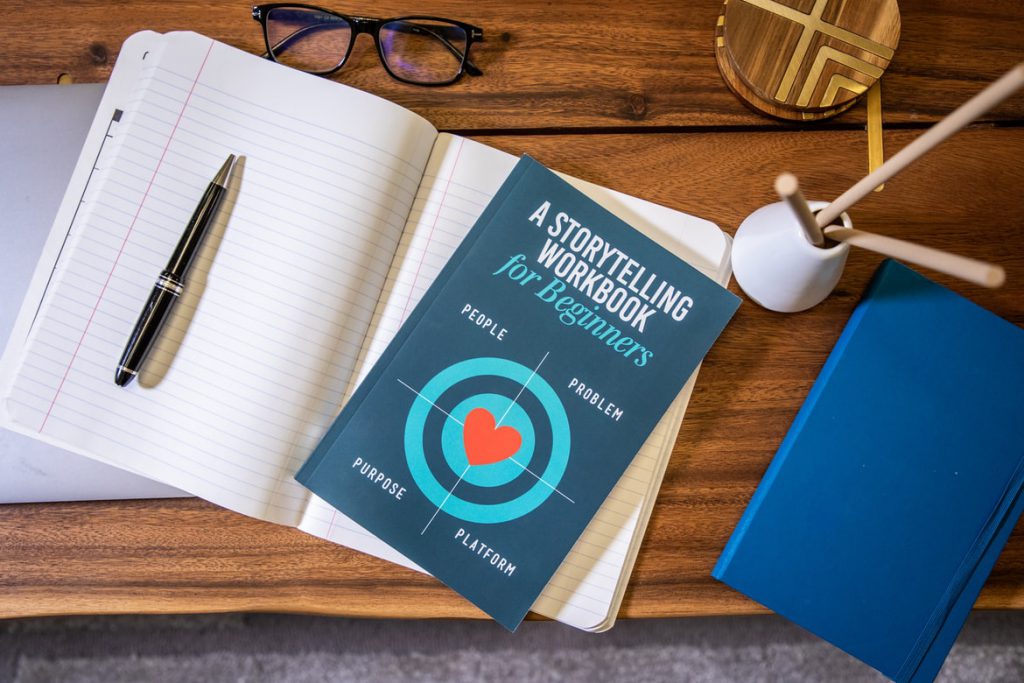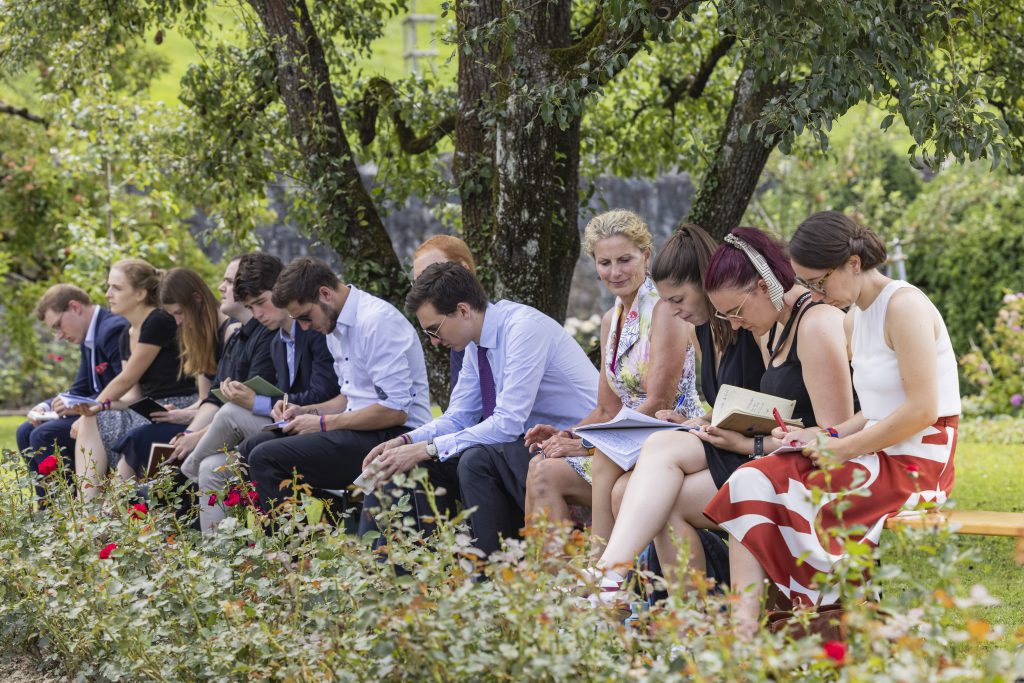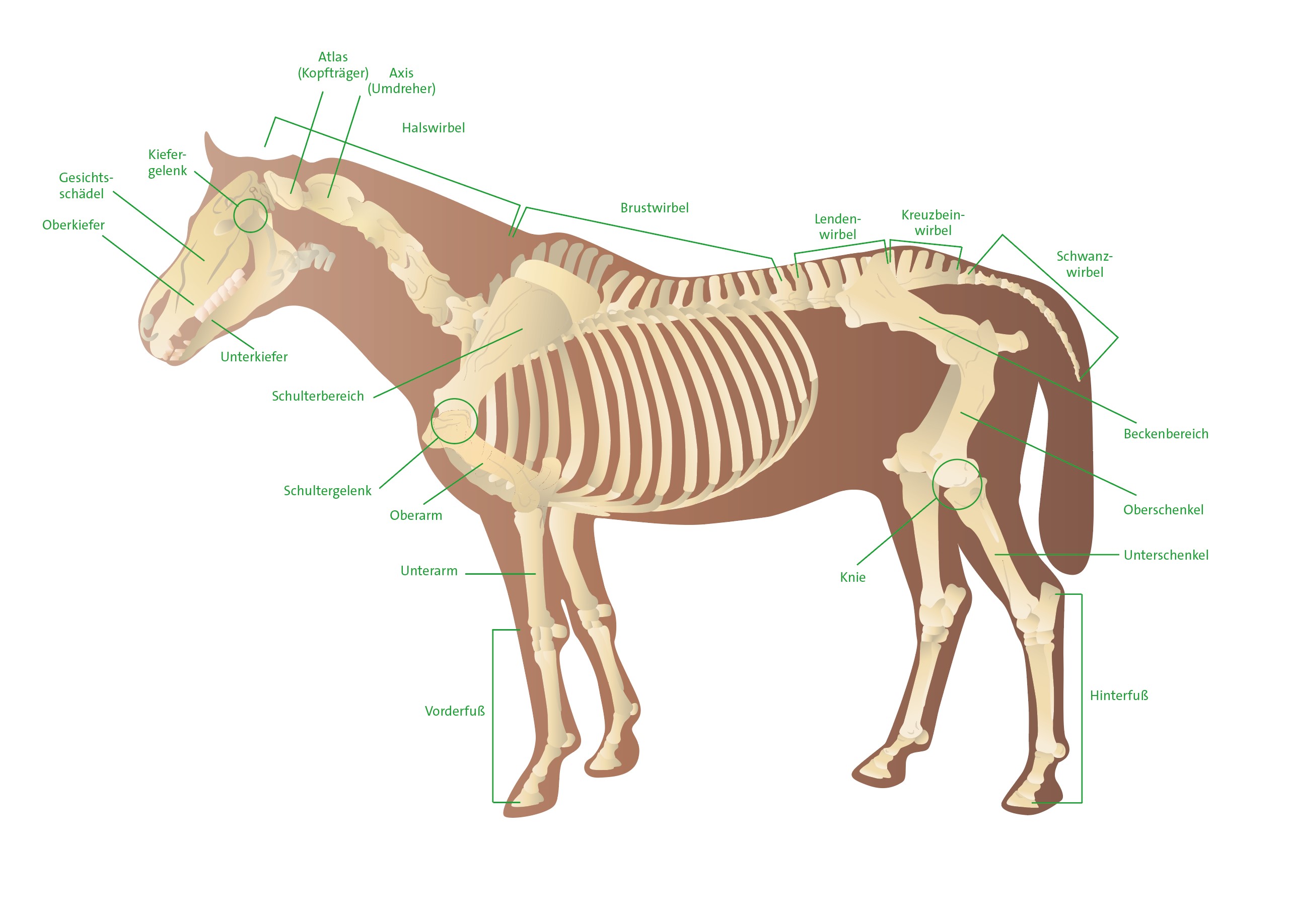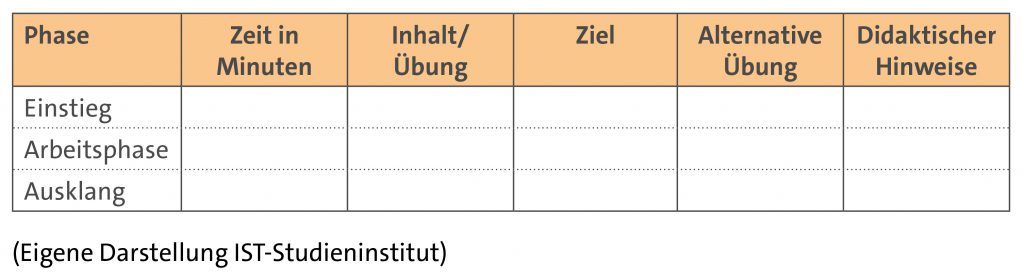Für Gastronomen ist die Speisekarte das einzige Marketingmedium, mit dem wirklich jeder Gast in Kontakt kommt. Obwohl die Speisekarte damit ein erhebliches Potenzial zur Umsatz- und Gewinnsteigerung besitzt, wird diese vielerorts nur als notweniges Mittel zur Angebotsinformation gegenüber den Gästen gesehen.
Nachfolgend wird aufgezeigt, wie einfach es für Gastronomen sein kann, mittels psychologischer Tricks die Speisekarte zu optimieren und dadurch deutlich höhere Umsätze zu erzielen.
1. Der Halo-Effekt – erste Eindruck zählt
Noch bevor ein Gast beim Servicepersonal bestellt hat, hat dieser sich anhand der Speisekarte eine fundierte Meinung über das Essen und das Restaurant gebildet. In der Psychologie spricht man hierbei vom „Halo-Effekt“, bei dem Menschen auf Grundlange von bereits bekannten Eigenschaften unbewusst auf unbekannte Merkmale schließen. Haben Gäste im Restaurant beispielsweise eine qualitativ hochwertige Speisekarte in der Hand, schließen sie nur anhand der Optik und Haptik der Karte, dass auch das Restaurant und das Essen gut sein müssen. Macht dagegen die Karte keinen guten Eindruck, beispielsweise weil diese klebrig ist oder weil einige Seiten eingerissen sind, beginnen die Gäste unbewusst zu fragen, ob sie mit dem Restaurant eine falsche Wahl getroffen haben. In der Folge nehmen sie von einer Bestellung Abstand oder wählen die preisgünstigsten Gerichte.
Es ist daher wichtig, beim Gast mit der Speisekarte einen positiven (ersten) Eindruck zu erzeugen, indem diese in einem sauberen, gepflegten und einwandfreien Zustand ist. Achten Sie hierbei auch auf mögliche Tippfehler, eine ansprechende Gestaltung sowie eine hochwertige Qualität der dabei verwendeten Materialien.
2. Das Auswahlparadox – weniger ist mehr
Sicherlich jeder Restaurantbesucher sah sich schon einmal mit der Situation konfrontiert, bei der man statt einer Speisekarte, gefühlt einen ganzen Roman in der Hand gehalten hat. Dahinter steckt der naheliegende Gedankengang vieler Gastronomen und Hoteliers, dass ein großes Angebot auch die Gäste glücklich macht – schließlich müsste bei einer großen Auswahl für jeden etwas dabei sein.
In der Realität entpuppt sich diese Annahme leider als Trugschluss. Denn ein großes Angebot führt paradoxerweise nicht zu glücklicheren, sondern zu unglücklicheren Gästen. Der Grund hierfür ist, dass eine große Auswahl zu einer kognitiven Überforderung des Gastes und zu einer „Angst vor einer falschen Wahl“ führt, wodurch viele Gäste im Anschluss mit ihrer getroffenen Wahl unzufrieden sind. Gleichzeitig wirft eine große Speisekarte auch unvorteilhafte Fragen bezüglich des Restaurants auf: Können die das alles? Kann das alles wirklich frisch sein? Nicht selten werden diese unbewussten Fragen zusätzlich mit einem Kopfkino aus Konserven- und Tiefkühlkost begleitet.
Bedenken Sie daher auch bei Ihrer Speisekarte: In der Kürze liegt die Würze! Verzichten Sie auf ein überforderndes Angebot und halten Sie Ihre Karte übersichtlich. Eine überschaubare Karte, bei denen Ihre Gäste nicht das Gefühl haben einen ganzen Roman lesen zu müssen, suggeriert Frische und Qualität. Auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit ist eine kleinere Karte von Vorteil, da Lager- und Zubereitungskosten eingespart werden. Zusätzlich vermeiden Sie das erwähnte Auswahlparadox, wodurch die Zufriedenheit Ihrer Gäste mit den bestellten Gerichten steigt.
Tipp: Sehen Sie das Feedback Ihrer Gäste, bei denen der Wunsch nach einem größeren Angebot geäußert wird, kritisch. Zahlreiche Untersuchungen zu großen Angeboten zeigen immer wieder eine enorme Diskrepanz zwischen den angeblichen Wünschen und dem am Ende tatsächlichen Verhalten von Kunden.
3. Der Ankereffekt – teure Gerichte gehören nach oben
Einen verblüffend einfachen Trick für mehr Umsatz bietet der „Ankereffekt“, bei dem man teure bis sehr teure Gerichte und Getränke als erstes in der Karte auflistet. Der Wirkmechanismus des Ankereffekts arbeitet ähnlich wie ein physischer Anker in der Schifffahrt, welcher einmal ausgeworfen dafür sorgt, dass sich ein Schiff nur noch minimal vom Ankerplatz bewegen kann. Führt man in seiner Karte als erstes teurere Gerichte auf, werden diese vom Gast unbewusst als Referenzwert genutzt, wodurch im Vergleich alle anderen Speisen preiswert erscheinen und dadurch verstärkt bestellt werden.
Ein Beispiel: Liegen die Preise für ein Glas Wein bei acht bis zwölf Euro, kann dies für sich alleine betrachtet vom Gast als teuer empfunden werden. Listet man jedoch davor eine Flasche Champagner für 200 Euro auf, wirken die Weinpreise plötzlich deutlich günstiger.
Wichtig zu beachten ist, dass es beim Ankereffekt nicht vordergründig darum geht, den Verkauf der teuersten Gerichte und Getränke zu steigern, sondern darum, die Preiswahrnehmung und -sensibilität des Gastes zum Vorteil des Gastronomen zu verändern. Würde ein Gast ohne den Ankereffekt vielleicht nur für 40 Euro Speisen und Getränke bestellen, so wird er durch die veränderte Preiswahrnehmung des Ankereffekts nun für 50 bis 60 Euro Speisen und Getränke ordern.
Tipp: Beachten Sie bei Ihrer Speisekarte auch unbedingt den Deckungsbeitrag Ihrer Gerichte und Getränke. Nicht immer sind die teuersten auch die gewinnbringendsten für Sie.
4. Vermeiden Sie eine durchgehende Preissortierung
Beim Ankereffekt haben wir erwähnt, dass die teuersten Gerichte als erstes auf der Karte angeführt werden sollten. Doch das bedeutet nicht, dass diese durchgehend von teuer zu günstig sortiert werden müssen. Denn schnell führt solch eine Sortierung dazu, dass viele Gäste sich nicht mehr auf ihr Essen, sondern nur noch auf den Preis konzentrieren und dadurch häufig die preisgünstigen Gerichte bestellen.
Bauen Sie daher zwischendurch immer wieder Gerichte und Getränke ein, die die teuer-zu-günstig Sortierung stören (z. B. Gericht A: 29,95 Euro; Gericht B: 24,50 Euro; Gericht C: 21,95 Euro; Gericht D: 23,95 Euro). Sie erschweren dadurch für Ihren Gast den Preisvergleich und vermeiden gleichzeitig die Fokussierung auf die preisgünstigsten Gerichte.
Den Effekt können Sie zusätzlich verstärken, indem Sie darauf verzichten, Preise akkurat in einer Spalte untereinander aufzulisten und stattdessen die Preise etwas versteckt am Ende der Beschreibung des jeweiligen Gerichts platzieren.
5. Währungssymbole weglassen und Zahlungsschmerz vermeiden:
Jeder Restaurantbesucher weiß, dass man für bestellte Speisen und Getränke bezahlen muss. Smarte Gastronomen sind jedoch gut beraten, wenn sie ihre Gäste auf diesen (logischen) Umstand nicht allzu offensichtlich hinweisen. Denn das Ausgeben von Geld ist mit negativen Emotionen verbunden, dem sogenannten „Zahlungsschmerz“. Dabei gilt: Je mehr ein Kauf uns schmerzt (also je größer der Zahlungsschmerz), desto weniger sind wir bereit, einen Kauf zu tätigen.
Untersuchungen aus der Preispsychologie haben ergeben, dass man die Preissensibilität und den Zahlungsschmerz von Menschen deutlich reduzieren kann, indem man Preise ohne Währungssymbol auszeichnet. Sie erreichen damit, dass die Preise von Ihren Gästen als günstiger empfunden werden und vermeiden zusätzlich, dass diese ausschließlich auf Grundlage günstiger Preise bestellen.
Tipp: Zur Wahrung rechtlicher Bestimmungen reicht es aus, wenn Sie in der Fußzeile kurz darauf hinweisen, in welcher Währung die Preise ausgezeichnet sind.
6. Mehr Umsatz und höhere Trinkgelder mit Kreditkarten
Viele Gastronomen lehnen auch heute noch Kreditkartenzahlungen ab, da hier höhere Zahlungsentgelte anfallen. Zu Unrecht, wie die psychologische Forschung zeigt. Wie wir im vorherigen Abschnitt erfahren haben, besitzt der Zahlungsschmerz erhebliche Auswirkungen auf das Konsumverhalten von Menschen. Während Bezahlvorgänge mit Bargeld einen hohen Zahlungsschmerz verursachen, lösen Kreditkartenzahlungen nur einen geringen Zahlungsschmerz aus. Wenig überraschend konnte in diesem Kontext eine Studie aus dem Jahr 1986 nachweisen, dass Restaurantgäste deutlich mehr ausgeben und höhere Trinkgelder geben, wenn sie mit Kreditkarte statt Bargeld zahlen.
Interessanterweise konnten nachfolgende Studien zeigen, dass Menschen nicht zwingend im Besitz einer Kreditkarte sein müssen, um in Ausgabenfreude zu verfallen. Hierfür reicht es bereits aus, dass ein Kreditartenlogo auf der Speisekarte oder auf der Rechnung abgedruckt ist, damit Gäste durchschnittlich 29 Prozent mehr ausgeben – selbst dann, wenn diese anschließend mit Bargeld zahlen.
Wenn Sie Kreditkartenzahlungen akzeptieren und von höheren Umsätzen profitieren möchten, dann zeigen Sie Kreditkartenlogos gut sichtbar für all Ihre Gäste (beispielsweise an der Wand, in Ihren Speisekarten oder auf Ihren Rechnungen). Wenn Sie keine Kreditkartenzahlungen akzeptieren möchten, können Sie dennoch eine Umsatzsteigerung erreichen, indem Sie auf Symbole ausweichen, die an Kreditkarten erinnern.
7. Hochwertige Wortwahl und Fotos
Mehrere Studien konnten nachweisen, dass der Restaurantumsatz um bis zu 30 Prozent gesteigert werden kann, wenn die Gerichte in den Speisekarten eine gute Beschreibung haben. Hintergrund ist, dass lebendige Beschreibungen Appetit machen und die Gäste gleichzeitig die Überzeugung entwickeln, ein besonderes Mahl genießen zu können. In der Folge sind die Gäste mit ihren Gerichten zufriedener und bewerten diese auch besser.
Sie können diesen Umstand auf einfache Weise bei sich selbst testen: Welche der beiden folgenden Beschreibungen sagt Ihnen mehr zu?
a. Hüftsteak mit Kartoffeln und Pilzen
b. Saftiges Hüftsteak von Allgäuer Rind mit kross angebratenen Kartoffelscheiben und marinierten Champignons.
Selbstverständlich sollte die Art und Weise, wie Sie Ihre Speisen und Getränke beschreiben, zu Ihrem Lokal passend sein. Klassische und hilfreiche Wörter sind hierbei: handgemacht, saftig, frisch, hausgemacht, würzig, knusprig, 31 Tage gereift, zart, ausgewählt, traditionell, oder sonnengereift.
Als besonders effektiv haben sich Beschreibungen mit passenden hochwertigen Fotos der Gerichte und Getränke erwiesen. Diese unterstützen das Kopfkino und steigern nochmals den Appetit des Gastes.
Tipp: Beachten Sie, dass Sie es mit den Beschreibungen und Bildern nicht übertreiben. Zu blumige Beschreibungen und zu viele Bilder wirken schnell unseriös und kitschig.
Quellen: www.lajkonik-content.de/ratgeber/
www.lajkonik-content.de/verkaufspsychologie/