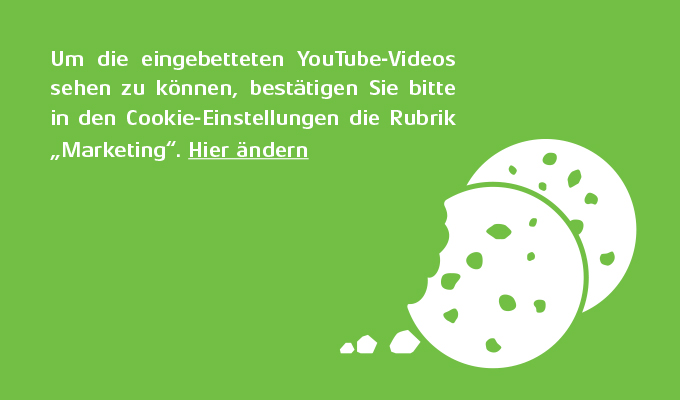Blog der IST-Hochschule
Fitness & Gesundheit

Wie sicher sind Bio-Lebensmittel?
Der „Welttag der Lebensmittelsicherheit“ wird jährlich am 7. Juni begangen und bietet Gelegenheit, auf die Bedeutung sicherer Lebensmittel für unsere Gesundheit aufmerksam zu machen. Ziel dieses Tages ist es, Verbraucher:innen über Risiken und verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln zu informieren sowie die Bemühungen von Behörden, Herstellern und Händlern in der Sicherstellung der Qualität zu würdigen.
WeiterlesenSport & Management

Kraft ohne Bewegung: Isometrisches Training für Pferde erklärt
Isometrisches Training für Pferde ist eine gezielte Methode, um die Muskulatur zu stärken, ohne dabei Gelenke zu belasten. Diese Art des Muskeltrainings ist besonders vorteilhaft für Pferde in der Rehabilitation, mit Bewegungseinschränkungen oder zur gezielten Kräftigung einzelner Muskelgruppen. In diesem Beitrag erfährst du, wie isometrische Übungen funktionieren und welche Vorteile sie für dein Pferd haben.
WeiterlesenGesund durch die Boxenruhe: Fitness- und Wohlfühltipps für Dein Pferd
Spielerberater im Fußball – Die Qualität ist entscheidend
Effektives Training für Muskulatur, Sehnen, Bänder und Knochen: Grundlagen für ein gesundes Pferd
Event & Medien

Eventmanager:in werden – Aufgaben, Skills und Karrierewege im Überblick
Große und kleine Veranstaltungen planen, feierfreudige Menschen begeistern und kreative Eventkonzepte entwickeln – das klingt für Dich nach einem Traumjob? Dann ist Eventmanagement möglicherweise eine spannende Branche für Deine berufliche Zukunft. In diesem Beitrag nehmen wir einmal genauer unter die Lupe, was hinter dem Beruf von Eventmanager:innen steckt, welche Aufgaben sie im Alltag zu bewältigen haben, welche Karrieremöglichkeiten es gibt und ob sich der Karriereweg lohnt.
WeiterlesenDigitalisierung & Wirtschaft

KI-Schulungspflicht: Was jetzt auf Unternehmen zukommt
Künstliche Intelligenz verändert schon jetzt unsere Arbeitswelt: schnell, tiefgreifend und unumkehrbar. Ob im Marketing, in der Kundenbetreuung, bei der Datenanalyse oder der Softwareentwicklung – immer mehr Unternehmen integrieren KI in ihre Prozesse, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Kommunikation zu automatisieren oder Produktionsabläufe zu optimieren. Doch mit den neuen Möglichkeiten wächst auch die Verantwortung – vor allem gegenüber Mitarbeiter:innen.
WeiterlesenMit Herz und Strategie: Diese Aufgaben erwarten Dich in der Personalabteilung!
Business Coaching - Neue Perspektiven für erfolgreiche Führungskräfte
Tourismus & Hospitality

Reiseberater:in werden: Mit Fernweh zum Erfolg
Wer gerne reist, Organisationstalent besitzt und Freude daran hat, anderen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu ermöglichen, hat vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, Reiseberater:in zu werden.
WeiterlesenLernen & Studieren
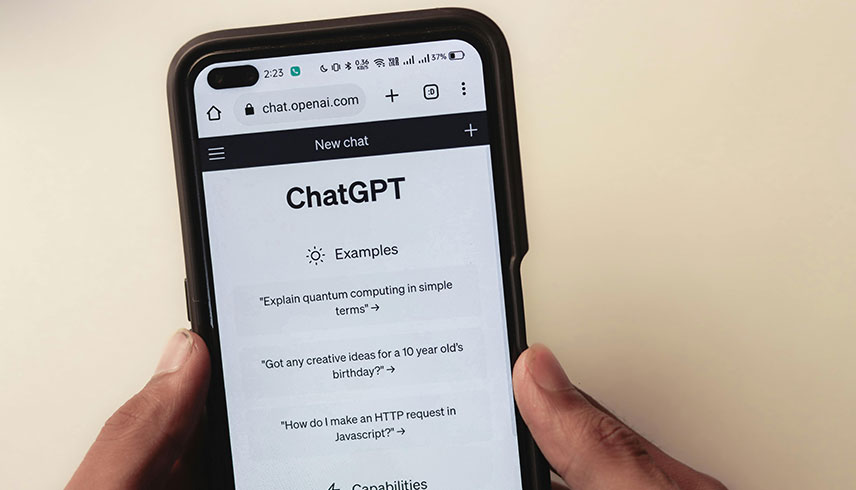
Prompting – der Schlüssel zur effektiven KI-Nutzung
Künstliche Intelligenz (KI) verändert Alltag und Arbeitswelt rasant. KI-Tools bieten enormes Potenzial, Prozesse effizienter zu gestalten. Damit Du dieses Potenzial voll ausschöpfen kannst, ist der richtige Umgang entscheidend – insbesondere mit dem sogenannten Prompting.
WeiterlesenZwei Alumni berichten: Das bringt das IST-Mentoringprogramm wirklich
Deutschlandstipendium: Ein Sprungbrett für Spitzenleistungen
Zu den Studiengängen der
IST-Hochschule
HIER KLICKEN!
IST-Hochschule
Zu den Weiterbildungen des
IST-Studieninstituts
HIER KLICKEN!
IST-Studieninstitut